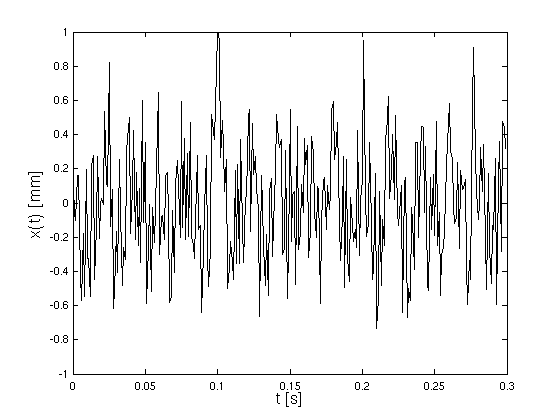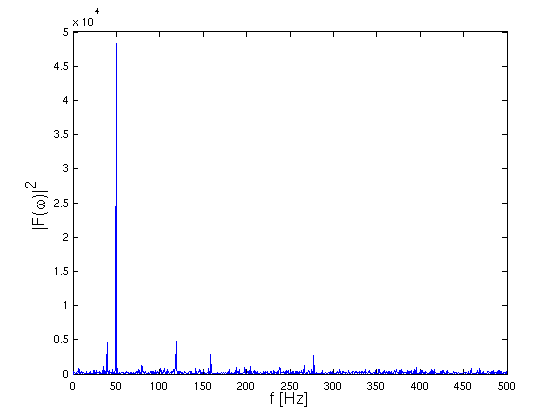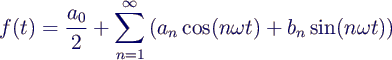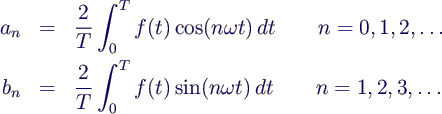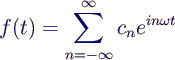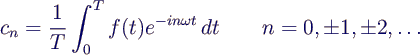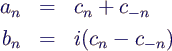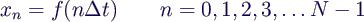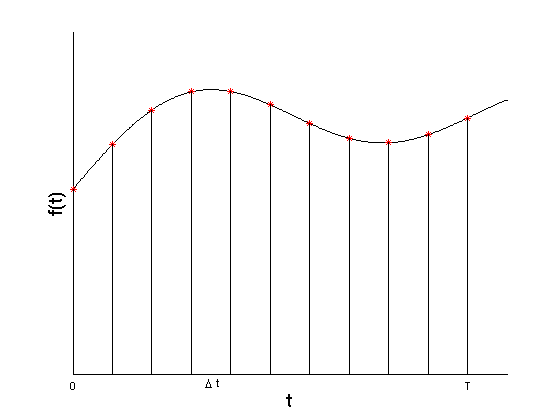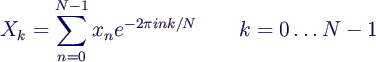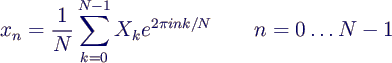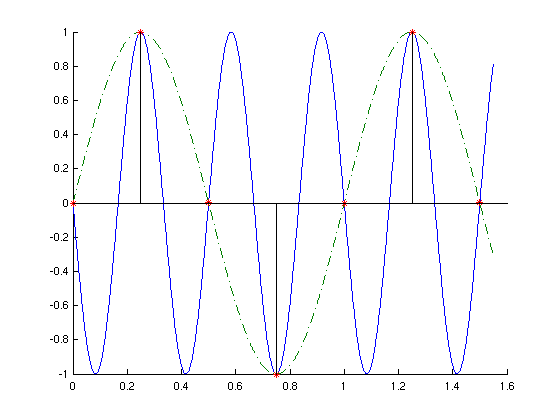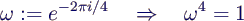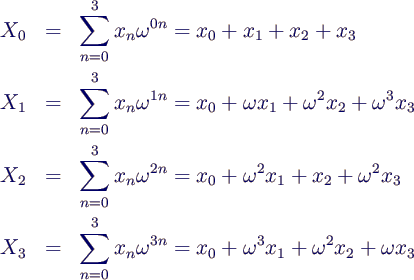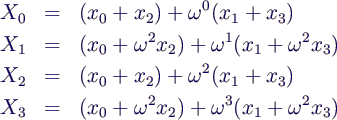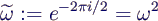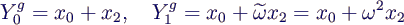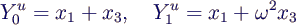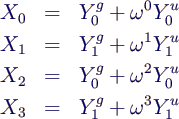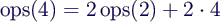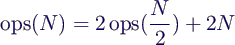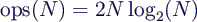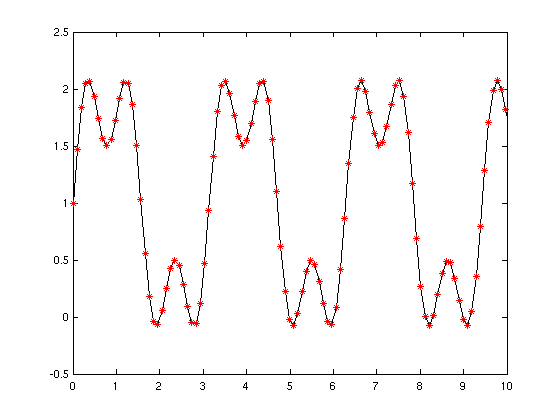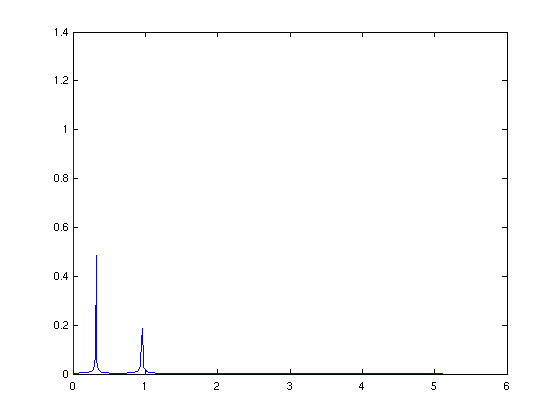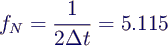Fourieranalyse
- Analyse von Störschwingungen:
- seltsame Störungen in einer Maschine, hervorgerufen
durch Vibrationen unbekannter Herkunft
- Messung der Vibrationen ergibt
- Spektralanalysator zeigt
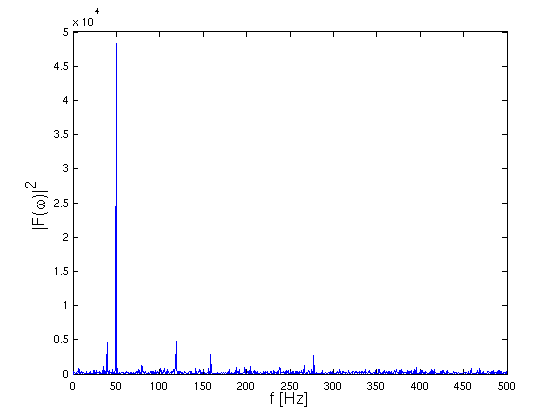
- große Spitze bei 50 Hz
- Spitzen in festen Frequenzabständen (Grundfrequenz
39.6 Hz)
- Untergrund bei allen Frequenzen
- Interpretation
- Rauschen (Messfehler + allgemeine Störungen) als
Untergrund
- Trafoschwingungen bei 50 Hz
- besondere Störung mit Grundfrequenz 39.6 Hz
- Fourierreihe:
- Zerlegung einer periodischen Funktion f(t) mit Schwingungsdauer
T in Sinus- und Kosinus-Schwingungen
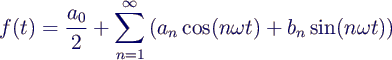
- mit ω := 2 π/T
- Berechnung der Koeffizienten
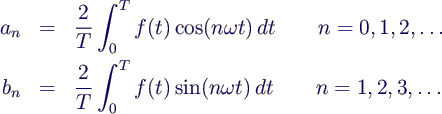
- liefert bei endlicher Reihe beste Approximation "im
quadratischen Mittel" [11]
- konvergiert für stückweise stetiges beschränktes
f im Mittel [11]
- Zusammenfassung als komplexe e-Funktion
- Berechnung der komplexen Koeffizienten
- Bestimmung von an und bn aus cn
- Beispiel Sägezahnschwingung:
- f(t) = t/2 für t = -π .. π
- Aufbau aus Grund- und Oberschwingungen
- als Applet zum Experimentieren
- Koeffizienten
- Fourierreihe also
- f(t) = sin(t) - 1/2 sin(2t) + 1/3 sin(3t) - 1/4 sin(4t)
...
- Spektrum (Darstellung der Größe der Koeffizienten
über der Frequenz)
- Abtasten einer Funktion (Sampling):
- in der Praxis Funktion f meistens nicht explizit bekannt
- stattdessen werden Werte der Funktion f in festen Zeitabständen
Δt gemessen
- z.B. Messung im Schwingstand alle 1/100 s
- Abtastfrequenz (Sampling rate)
- insgesamt N Werte, also Messdauer
- Diskrete Fouriertransformation:
- Ausgangspunkt sind N Werte xn, n = 0, .. N
- 1 (gemessen in festen Zeitabständen Δt)
- Berechnung der diskreten Fouriertransformierten X(k) (analog
zu ck) mit
- Rücktransformation
- Achtung:
- nur Schwingungen bis zur Nyquist-Frequenz fN
= fS/2 messbar
- Schwingungen höherer Frequenz f tauchen bei niedrigeren
Werten 2 fN - f auf (Aliasing)
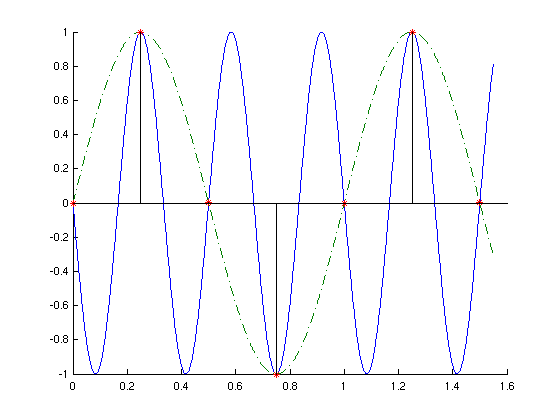
- Fast Fourier Transformation (FFT):
- Zahl der Operationen ops(N) (Multiplikationen + Additionen)
bei direkter Berechnung von Xk
- N Multiplikationen, N-1 Additionen für ein Xk
- N2 Multiplikationen, N*(N-1) Additionen
für alle Xk
- → ops(N) = 2*N2 - N
- starke Reduktion des Aufwands bei geradem N mit "Umsortier-Trick"
- Beispiel N = 4
- Mit der Abkürzung
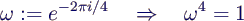
- erhält man die Fouriertransformierte Xn
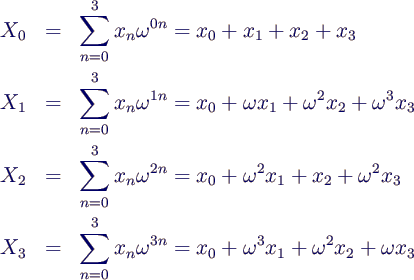
- was sich umsortieren lässt zu
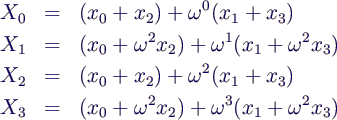
- Die Fouriertransformierte Ygn
der "geraden Werte" x0 und x2 berechnet
man mit
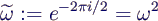
- zu
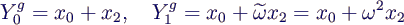
- Analog ist die Fouriertransformierte Yun
der "ungeraden Werte" x1 und x3
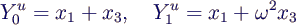
- Also kann man die Fouriertransformierte der 4 Werte
auf die von jeweils 2 zurückführen
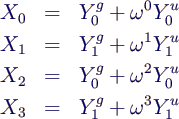
- Für die Zahl der Operationen ergibt sich somit
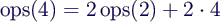
- ganz analog zeigt man für beliebiges gerade N (s.
Anhang)
- falls N eine Zweierpotenz ist, folgt aus dieser Beziehung
durch wiederholte Anwendung des "Umsortier-Tricks" (s. Anhang)
- dies ist für große N eine dramatische Zeitersparnis,
etwa bei 1 ns pro Operation
-
| N |
ops normal |
ops FFT |
| 1024 |
2 ms |
20 μs |
| 1048576 |
2199 s |
0.042 s |
| 1073741824 |
73 a |
64 s |
- 1000x1000 Fouriertranformationen häufig (z.B.
Bildbearbeitung)
- man wählt (fast) immer N als Zweierpotenz, notfalls
mit Nullen auffüllen
- FFT mit Matlab:
- grundlegende Funktionen
- da X komplex, häufig nur Betrag oder Betragsquadrat
(Leistungsspektrum) interessant
- Darstellung des Spektrums
- nur bis zur zulässigen Maximalfrequenz
- x-Achse in richtigen Einheiten (z.B. in Hz)
- Matlabvektoren beginnen bei 1, Frequenzen fangen bei
0 an
- → Indizes um 1 verschieben
- Anwendungsbeispiel in Matlab:
- Ausgangsfunktion
- f = @(t) 2 + sin(2*t) + 0.5*sin(6*t);
- gesampelt über Zeit T, N Werte
- T = 100;
N = 1024;
Delta_t = T/(N-1);
t = [0:N-1]*Delta_t;
x = f(t);
- Samplewerte (Ausschnitt!)
- FFT
- X = fft(x);
F = abs(X(1:N/2))/N;
freq = [0:(N/2)-1]/T;
plot(freq, F);
- Spektrum
- maximale Frequenz (Nyquist-Frequenz)
- Wert bei f = 0 ist Mittelwert
- Aufgaben: